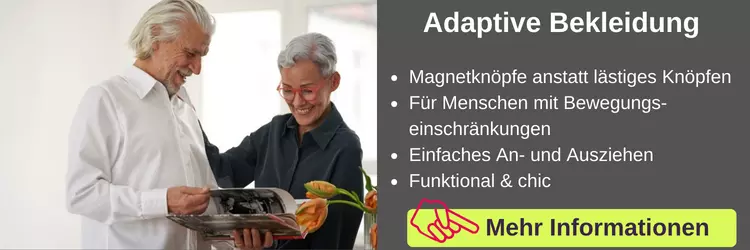Ist ein Dekubitus bereits vorhanden, muss er fachmännisch behandelt werden, um schwerwiegende Folgeschäden zu vermeiden. Die Dekubitusprophylaxe ist vor allem bei bettlägerigen Menschen unerlässlich. Die Behandlung und die Prophylaxe eines Dekubitus gehören in fachmännische Hände, denn leider wird hier oftmals noch vieles falsch gemacht.
Definition – Was ist ein Dekubitus?
Ein Dekubitus (auch Druckgeschwür genannt) ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und/oder des darunter liegenden Gewebes, typischerweise über knöchernen Vorsprüngen, infolge von Druck oder von Druck in Verbindung mit Scherkräften. *
Ein Dekubitus ist kein eigenständiges Krankheitsbild, vielmehr eine Folge- bzw. Sekundärerkrankung. Die Häufigkeit der Entstehung eines Dekubitus nimmt mit dem Alter zu. Neben älteren, pflegebedürftigen Menschen sind insbesondere multimorbide (=mehrfach-erkrankte) Menschen betroffen z.B. nach einem Schlaganfall.
Das Thema Dekubitus und Dekubitusprophylaxe beschäftigt Pflegefachkräfte, sowie pflegende Angehörige gleichermaßen. Zumal ein „Wundliegen“ mit gezielten, geschulten Maßnahmen, sowie speziellen Hilfsmitteln therapiert oder ganz verhindert werden kann.
Nicht außer Acht zu lassen, wenn es um Dekubiti geht, ist das Thema „Schmerz“. Eine betroffene Person leidet unter permanenten, teils sehr starken Schmerzen, die nur mittels Schmerztherapie beseitigt werden können. Die Heilung/ Therapie eines Dekubitus dauert oft Monate, eine sehr belastende Zeit für alle Beteiligten, da Betroffene oft schildern sie haben das Gefühl „bei lebendigem Leib zu verfaulen“. Daher wird oft der Kontakt selbst zu nahestehenden Angehörigen vermieden. Eine häufige Folge ist eine Depression.
- Daher das Ziel: Vermeidung eines Druckgeschwürs.
- Die wichtigsten Maßnahmen dazu sind: Mobilisierung, Druckentlastung, Bewegungsförderung sowie richtige Positionierung.
Achtung: „Nicht jeder Dekubitus kann vermieden werden, aber es ist möglich, die Häufigkeit des Auftretens zu vermindern“ (Schröder 2007, DNQP2010)
Welche Stadien eines Dekubitus gibt es?
Die Einteilung, Beschreibung und Erkennungsmerkmale eines Dekubitus wird in vier Stadien / Kategorien voneinander unterschieden.
Mit dem Fingerdruck („Fingertest“) nicht „wegdrückbare“ Rötung der intakten Haut.
Dieser betroffene Bereich kann sehr schmerzempfindlich, wärmer oder kälter als das restliche Gewebe in der Umgebung sein, sowie verhärtet wirken.
→ bei kontinuierlicher Druckentlastung verschwindet diese Hautrötung innerhalb weniger Stunden wieder. Findet jedoch keine, oder nicht ausreichende Druckentlastung statt, kann es zu Einlagerung von Flüssigkeit mit Blasenbildung kommen.
Teilzerstörung der Haut. (Bis in die Dermis/Lederhaut)
Noch ist der Schaden der betroffenen Körperstelle in Form einer Blase zu sehen, oder einer oberflächlichen Hautabschürfung, ein flaches Geschwür.
→ in diesem Stadium ist die Wunde nässend und sehr infektionsanfällig.
Zerstörung aller Hautschichten. Schädigung des subkutanen Gewebes bis hin zu Nekrosen (abgestorbenes Gewebe).
→ Der Dekubitus ist nun ein tiefes, offenes Geschwür.
Totaler Gewebsverlust, mit teils freiliegenden Muskeln, Sehnen oder Knochen.
Risikofaktoren und Risikoeinschätzung
Bei den Risikofaktoren wird zwischen extrinsischen Faktoren (von außen einwirkend) und intrinsischen Faktoren (personenbezogen) unterschieden.
| Extrinsische Faktoren sind: | Druck & Scherkräfte |
| Intrinsische Faktoren sind: | Einschränkung in der MobilitätHerz-/KreislauferkrankungenHauterkrankungen, Hautfeuchtigkeit |
In der Pflege von Angehörigen kann es schwierig sein, Risiken wie Druck oder Scherkräfte richtig einzuschätzen und frühzeitig zu erkennen. Pflegende Angehörige sollten daher gut geschult und beraten werden um Risikofaktoren besser erkennen zu können und ggf. Maßnahmen zu ergreifen.
Pflegende Angehörige können dazu auch kostenlose Pflegeschulungen beantragen.
Wichtig sind regelmäßige, engmaschige Hautinspektionen. Insbesondere die Fersen sind gefährdet.
Stellt man eine Rötung fest, sollte der „Fingertest“ durchgeführt werden. Hierzu drückt man kurz auf die gerötete Hautstelle und nimmt den Finger wieder weg, wird die Haut an dieser Stelle weiß, besteht nur eine oberflächliche Rötung. Bleibt die Stelle jedoch rot, lässt sich also nicht „wegdrücken“ handelt es sich bereits um einen Dekubitus im Stadium 1.
Zur Risikoeinschätzung eines Dekubitus sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:
- Ist die Mobilität eingeschränkt? (z.B. durch Lähmung, Erkrankung, Schmerz, Sedierung, Schonhaltung)
- Ist das Bewusstsein und/oder Sensibilität eingeschränkt? (z.B. durch Narkose, Lähmung oder Polyneuropathien bei Diabetes)
- Gibt es medizinische Hilfsmittel / Geräte mit direktem Hautkontakt? (z.B. Katheter, Ernährungssonden, Verbände / Gips, Anti-Thrombose-Strümpfe)
- Besteht bereits ein Druckgeschwür, oder ein abgeheilter Dekubitus?
- Untergewicht, Mangelernährung oder Flüssigkeitsmangel
- Alter
- Inkontinenz und dadurch hervorgerufene feuchte Hautstellen.
Es gibt eine Vielzahl von Risikoskalen zur Bewertung des individuellen Dekubitusrisikos. In Deutschland werden am häufigsten die „Norton-Skala“ und die „Braden-Skala“ verwendet.
| ☛ Nützlich + Hilfreich 24h-Pflegekräfte aus Osteuropa. Zuhause leben statt im Heim ! |
Die Haut und ihre Funktion / Aufgabe
Um die Entstehung, und die daraus resultierte Problematik eines Druckgeschwürs besser zu verstehen ist es wichtig, sich kurz mit der Funktion und dem Aufbau der Haut zu befassen.
Die Haut ist das größte Organ im menschlichen Körper. Sie hat eine Fläche von ca. 1,5 – 1,8 m² und wiegt in etwa 3,5 – 10 kg.
Die Aufgaben der Haut:
- Schutz: Die Haut dient dem Körper als Schutzmechanismus vor sämtlichen äußeren Einflüssen.
- Sinnesorgan: Die Haut lässt uns „fühlen“. Vermittlung von z.B. Temperatur, Schmerz oder Druck.
- Säureschutzmantel: Der Säureschutzmantel unserer Haut wehrt verschiedene Krankheitserreger ab.
- Temperaturregulation: Durch Weit-/Engstellung unserer Gefäße kann die Haut unsere Temperatur regulieren.
- Wasserhaushalt: Die Haut schützt unseren Körper einerseits vor Austrocknung, anderseits gibt sie Flüssigkeit und Salze ab.
Ist die Haut intakt, kann sie die Vielzahl ihrer Aufgaben und Funktionen erfüllen. Daher ist es umso wichtiger unsere Haut gut zu pflegen. Unerlässlich ist ebenfalls eine konsequente Beobachtung der Haut auf Veränderungen, Rötungen etc. um einem möglichen Dekubitus vorzubeugen.
Dekubitusprophylaxe – wie wichtig ist die Hautpflege?
Ein Baustein zur Dekubitusprophylaxe ist die richtige Hautpflege, wobei sich ein Dekubitus nicht alleine durch Cremes, Salben oder Lotionen verhindern lässt. Durch eine richtige Hautpflege soll die Gewebetoleranz gegenüber extrinsischen Faktoren (Druck, Reibung, Scherkräfte) erhöht werden.
Es gibt keinen eindeutigen Beleg dafür, dass spezielle Hautpflege einen Dekubitus verhindern kann. Ziel der Hautpflege ist unter anderem der Erhalt der physiologischen Beschaffenheit der Haut.
Natürlich ist eine gute Hautpflege noch aus anderen Gründen sehr wichtig. z.B. erhöht sie das Wohlbefinden des zu Pflegenden. Eine intakte Haut neigt weniger zu Infektionen oder wunden Stellen, verhindert Juckreiz durch zu trockene Haut.
Zur Hautpflege empfiehlt sich eine mit W/O gekennzeichnete Lotion; Also ein Wasser-in-Öl-Präparat, möglichst parfümfrei.
■ Unsere Lese-Empfehlung
Chronische Wunden – Ursachen, Behandlung, Herausforderungen
Mythen in der Dekubitusprophylaxe
Leider halten sich immer noch viele veraltete „Weisheiten“, wie ein Dekubitus behandelt werden sollte. Diese Behandlungen bewirken manchmal eher das Gegenteil und behindern damit auch die Wundheilungsphase.
- „Eisen und Föhnen“ Jahrelang wurde das „Eisen und Föhnen“ zur Dekubitusprophylaxe praktiziert. Man ging davon aus, dass die Wechselwirkung durch Wärme/Kälte die Blutzirkulation im Gewebe verbessere. Untersuchungen ergaben jedoch, dass dies nicht der Fall war. Daher zählt diese Methode nicht mehr zur Dekubitusvorbeugung.
- Franzbranntwein und Co. Auch das einreiben mit alkoholischen Mitteln (z.B. Franzbranntwein) sind nicht zur Prophylaxe eines Dekubtus geeignet, da der Alkohol die Haut austrocknet und somit anfällig macht.
- Zinkpasten werden auch immer wieder zur Dekubitusprophylaxe eingesetzt. Auch dies ist nicht ratsam. Die weiße, recht dicke Paste deckt die Haut ab, was eine genaue Beobachtung erschwert, zudem lässt sie sich nur schwer entfernen. Zinkoxid hat auf intakter Haut keine sinnvolle Funktion, es trocknet die Haut eher aus.
- Fettprodukte Es werden immer noch reine Fettprodukte wie z.B. Vaseline, Melkfett oder Babyöl zur Hautpflege benutzt. Auch dies ist nicht zu empfehlen, da auf Grund der Abdichtung der Hautporen kein Wärmeaustausch stattfinden kann. Häufig befinden sich in Präparaten wie Melkfett oder Vaseline Zusätze wie Antibiotika oder Desinfektionsmittel.
Anzeige | Produktvorstellung
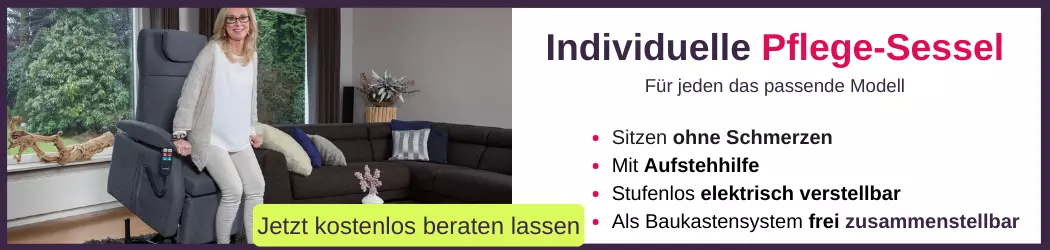
Dekubitusprophylaxe – Welche Hilfsmittel gibt es?
Die wichtigsten Maßnahmen zur Dekubitusvorbeugung sind:
- Mobilisierung
- Druckentlastung
- Druck verteilende Hilfsmittel
- Bewegungsförderung
- Richtige Positionierung.
Im Grundsatz gilt immer: „Bewegung vor Lagerung“.
Menschen, die nicht in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, bewegen sich auch im Liegen und Schlafen kontinuierlich, daher besteht in der Regel kein Dekubitusrisiko. Erst wenn es zu einer Einschränkung in der Beweglichkeit kommt, droht die Gefahr eines Dekubitus. Daher sollte das Ziel jeder pflegerischen Handlung die Förderung der Eigenbewegung sein.
- Wissenschaftlich belegt ist die Wirksamkeit der Druckverteilung zur Dekubitusprophylaxe.
- Jede Veränderung / Bewegung, der aufliegenden Körperfläche ist wirkungsvoll.
- Möglich ist auch der Gebrauch von druck-verteilenden Hilfsmitteln. (z.B. Lagerungskissen).
Bei allen Lagerungsmaßnahmen ist folgendes zu bedenken: Je weicher die Lagerung im Bett ist, desto geringer wird die Körperwahrnehmung. Die Gefahr einer Desorientierung besteht. Ebenso der Verlust des Körpergefühls. Es sollte immer darauf geachtet werden, die verbliebene Eigenbeweglichkeit zu fördern und zu erhalten.
Lagerung und Positionswechsel zur Druckentlastung im Liegen
Jede Lagerung erfolgt in individuell festgelegten Intervallen. Dafür wird der „Fingertest“ (s.o.) angewandt.
Wichtig bei jeder Lagerung ist zu wissen, was hat der Angehörige für Schlafgewohnheiten? Gab es eine „Lieblings-Schlaf-Position“? Überlegen Sie doch einmal selbst, in welcher Position schlafen Sie am liebsten ein? Und was würde es für Sie bedeuten in einer ungewohnten Position schlafen zu müssen?
Beispiel – 30° Lagerung:
- In dieser Lagerung besteht ein sehr geringes Dekubitusrisiko.
- Der Patient /der Angehörige liegt hierbei auf einem oder zwei weichen Kissen, welche unter eine Körperhälfte gelegt werden.
- Diese Position kann sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite angewandt werden.
- Allerdings entspricht diese Position in den meisten Fällen nicht der „natürlichen Schlafposition“ und wird meist nicht so gern eingenommen.
Beispiel – 135° Lagerung:
- Viele Menschen sind „Bauchschläfer“. Die beste Alternative zur Bauchlage ist die 135° Lagerung.
- Hierbei liegt der Kopf auf einem kleinen Kissen. Der Oberkörper wird auf ein kleines, weiches Kissen „gedreht“, das oben liegende Bein wird auf ein kleines Kissen gelegt, sodass das Knie und der Fuß frei liegen können.
Liegesysteme zur Dekubitusprophylaxe
- Weichlagerungs-Systeme (z.B. Schaumstoffmatratzen, Luftkissen)
- Wechseldruck-Systeme (z.B. kleinzellige Wechseldruckmatratzen)
- Systeme zur Stimulation der Mikrobewegung
Wichtig: Auch beim Einsatz eines speziellen Liegesystems ist die kontinuierliche Umlagerung trotz allem unumgänglich. Durch spezielle Liegesysteme können jedoch die Intervalle der Umlagerung verlängert werden.
Ungeeignete Hiflsmittel zur Dekubitus-Vorbeugung
Nach aktuellem pflegewissenschaftlichen Stand sollten folgende Hilfsmittel nicht mehr zur Dekubitusprophylaxe eingesetzt werden:
- Felle, jeglicher Art
- Wasserkissen/ Wassermatratzen
- Fellschuhe; Fersen- oder Ellenbogenschoner
- Sitzringe
- Watte / Watteverbände
Anzeige | Produktvorstellung

Dekubitusprophylaxe – Das richtige Bettklima
Bei allen prophylaktischen Maßnahmen sollte auch an das Bettklima gedacht werden. Oft liegen Patienten in einem nassgeschwitzten Bett. Dies ist nicht nur sehr unangenehm, sondern fördert zudem Erkältungen oder Verspannungen. Zu alledem sorgt eine permanente Feuchtigkeit zum Aufquellen der obersten Hautschicht.
Leider werden aufgrund von evtl. vorhandener Inkontinenz häufig jede Menge unnötiger Inkontinenzartikel in die Betten gelegt (z.B. Gummilaken). Durch diese staut sich Wärme und Feuchtigkeit.
Deshalb gilt bei Inkontinenzartikeln immer: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Nicht nur Inkontinenzmaterial kann zu einem schlechten Bettklima führen, auch falsche Bett- und Nachtwäsche kann vermehrte Schweißproduktion auslösen. Sowohl Bett- als auch Nachtwäsche sollten atmungsaktiv sein.
Die Beschaffenheit der Matratze hat ebenfalls großen Einfluss auf das Bettklima. Sie sollte Feuchtigkeit absorbieren können und atmungsaktiv sein.
Wissenswertes zum Bettklima:
- Der Verlust von etwa 700 ml Körperflüssigkeit pro Nacht ist völlig normal.
- Ein Drittel davon geben wir durch das Atmen ab.
- Zwei Drittel verteilen sich auf die Bettwäsche und die Matratze.
→ Von atmungsaktiver Bett- und Nachtwäsche und einer guten Matratze wird diese Flüssigkeitsmenge problemlos absorbiert.
Lese-Tipp:
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Fazit zum Umgang mit einem Dekubitus
- Nicht jede Hautrötung ist gleich ein Dekubitus!
- Kontinuierliche Druckentlastung, Mobilisation und Bewegungsförderung können dabei helfen einen Dekubitus zu verhindern.
- Bei allen Empfehlungen, Techniken und Hilfsmitteln sollte man auch immer die Vorlieben und Bedürfnisse des zu Pflegenden berücksichtigen und weitestmöglich in die Versorgung miteinbeziehen, um die Compliance (Mitwirkung des Patienten) an allen Maßnahmen zu fördern.

Fragen und Antworten zum Thema Dekubitus
Wie entsteht ein Dekubitus?
Ein Dekubitus entsteht, wenn Haut und Gewebe für längere Zeit unter Druck stehen und dadurch die Blutversorgung gestört wird.
Welche Bereiche des Körpers sind besonders gefährdet, von einem Dekubitus betroffen zu sein?
Bereiche des Körpers, die direkt auf Knochen liegen, sind besonders anfällig für einen Dekubitus. Dazu gehören z.B.
· das Steißbein,
· die Hüfte,
· die Fersen und
· die Schultern.
Welche Personen sind besonders gefährdet, einen Dekubitus zu entwickeln?
Menschen, die im Bett oder im Rollstuhl sitzen und sich nicht eigenständig bewegen können, haben ein höheres Risiko, einen Dekubitus zu entwickeln.
Wie kann man einem Dekubitus vorbeugen?
Eine gute Vorbeugung beinhaltet regelmäßiges Umlagern, das Verwenden von speziellen Lagerungshilfen und das Beobachten der Haut auf Anzeichen von Druckschäden.
Was sind die Anzeichen und Symptome eines Dekubitus?
Ein Dekubitus kann als gerötete, geschwollene oder verhärtete Hautstelle auftreten. In schwereren Fällen kann es zu offenen Wunden, Geschwüren oder Infektionen kommen.
Wie wird ein Dekubitus diagnostiziert?
Ein Dekubitus wird in der Regel anhand einer körperlichen Untersuchung durch einen Arzt diagnostiziert. Dabei werden die Hautveränderungen und das Ausmaß der Schädigung beurteilt.
Können Dekubitusinfektionen gefährlich sein?
Ja, Dekubitusinfektionen können sich ausbreiten und zu ernsthaften Komplikationen führen, wie zum Beispiel zu Infektionen der Knochen oder des Blutes.
Wie lange dauert es, bis ein Dekubitus heilt?
Die Heilungsdauer eines Dekubitus hängt von der Schwere der Schädigung und der allgemeinen Gesundheit der Person ab. Es kann Wochen bis Monate dauern.
Was kann man tun, um einem Dekubitus im Rollstuhl vorzubeugen?
Im Rollstuhl sollte man regelmäßig die Sitzposition wechseln, spezielle Polster verwenden und darauf achten, dass keine Falten in der Kleidung oder im Sitz entstehen.
Welche Maßnahmen helfen, Druckgeschwüren im Bett vorzubeugen?
Im Bett ist es wichtig, die Position häufig zu ändern, weiche Lagerungshilfen zu verwenden und die Haut regelmäßig zu inspizieren.
Ist ein Dekubitus ausschließlich ein Problem älterer Menschen?
Nein, Dekubitus können auch bei jüngeren Menschen auftreten, insbesondere wenn sie immobilisiert sind oder bestimmte Erkrankungen haben.
Was sind die Risikofaktoren für die Entwicklung eines Dekubitus?
Zu den Risikofaktoren zählen
· eingeschränkte Mobilität,
· Bettlägerigkeit,
· fortgeschrittenes Alter,
· schlechter Ernährungszustand,
· Inkontinenz,
· Hautprobleme und
· chronische Erkrankungen.
Welche Art von Bettzeug ist am besten, um Dekubitus vorzubeugen?
Spezielle Matratzen, Kissen und Auflagen aus druckentlastendem Material, wie z.B. Schaumstoff oder Gel, können helfen, den Druck auf die Haut zu verringern und das Risiko eines Dekubitus zu reduzieren.
Was kann man tun, um Rückfälle von Dekubitus zu verhindern?
Um Rückfälle zu vermeiden, ist es wichtig, die vorbeugenden Maßnahmen wie regelmäßige Umlagerung, Hautpflege und Druckentlastung fortzusetzen, auch wenn der Dekubitus bereits geheilt ist.
Weitere Beiträge zum Thema Pflege
Kostenloser Newsletter.
Beste Insider-Tipps!
Tipps zu: Pflegegeld + Pflegeleistungen, Kosten + Zuschüssen
Kurzzeit- u. Verhinderungspflege, Fehler bei MDK-Begutachtung, Entlastungsbetrag, Gesetzesänderungen uvm.
Tragen Sie sich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter ein, damit Sie sich zukünftig im Pflegedschungel zurecht finden. Unser Newsletter erscheint 1-2 Mal pro Monat.
*Quelle: dnqp/Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege
Quelle Bildmaterial:#Canva-Member © von MangTeng, Getty Images Pro
- Über den Autor
- Neuste Beiträge
Gemeinsam mit seiner Frau betreut Otto Beier seit 2012 seine pflegebedürftigen Eltern und Schwiegereltern. Er gibt Insider-Tipps für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen und schreibt als Pflegender – direkt von der Front – über seine Erfahrungen mit dem Pflegedschungel.
Mehr gibt es auch auf Facebook oder Xing, aber vor allem auch bei „Über mich“.