
Sterben ist für niemanden einfach, hängen wir doch in der Regel alle viel zu sehr am Leben. Gerade bei der Palliativpflege sieht man, wie sich vieles plötzlich verändert. In der Sterbephase können plötzlich Gefühle auftreten, die jahrelang unterdrückt wurden. Menschen werden einem wieder wichtig, mit denen man vielleicht schon „abgerechnet“ hatte. Ansichten und Meinungen können sich grundlegend ändern.
Unwichtiges wird plötzlich wichtig, Wichtiges ist nicht mehr relevant. Es gab Zeiten, da wurden die Gefühle und Wünsche totgeschwiegen, das Thema Sterben bei einem Todkranken ausgeklammert. Der Sterbende wurde allein gelassen.
Doch wer will das wirklich. Viele Sterbenden trauen sich nicht, ihre Angehörigen mit dem Thema zu belasten. Angehörige muntern den Sterbenden auf und tun so, als wäre alles in Ordnung, der Patient in bester Verfassung. Es findet keine Kommunikation statt, die doch so wichtig wäre. In der Palliativpflege ist dies anders.
Sie suchen einen Pflegedienst in Ihrer Nähe? ► Kostenlose Pflegedienst-Suche
Was ist Palliativpflege?
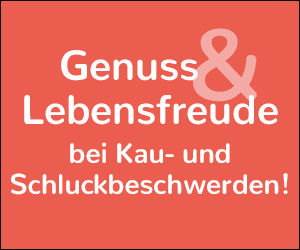 Anzeige
Vereinfacht formuliert: Die Palliativmedizin soll die Lebensqualität von Sterbenden so gut wie möglich erhalten, die Symptome lindern und so weit machbar die Schmerzen medikamentös verringern und das Leben so erträglich wie möglich machen. Die Palliativpflege kann über den Tod hinausgehen und orientiert sich an den Bedürfnissen des Patienten und seinen Angehörigen. Sie soll dem Patienten Sicherheit geben durch entsprechende Aufklärung.
Anzeige
Vereinfacht formuliert: Die Palliativmedizin soll die Lebensqualität von Sterbenden so gut wie möglich erhalten, die Symptome lindern und so weit machbar die Schmerzen medikamentös verringern und das Leben so erträglich wie möglich machen. Die Palliativpflege kann über den Tod hinausgehen und orientiert sich an den Bedürfnissen des Patienten und seinen Angehörigen. Sie soll dem Patienten Sicherheit geben durch entsprechende Aufklärung.
Hier können Sie nachlesen die wissenschaftliche Definition von Wikipedia.
Wie hilft die Palliativpflege weiter?
Die Palliativpflege umfaßt nicht nur die medizinische Versorgung, sondern ist eine ganzheitliche Betreuung. Nicht nur der Sterbende wird betreut, sondern auch seine Angehörigen. Sie werden in den Leidensweg und Sterbeprozess mit integriert. Bei der Hospizarbeit geht es nicht darum, dem Patienten mehr verbleibende Tage zu schenken, sondern die verbleibenden Tage so angenehm und erträglich wie möglich zu gestalten. Zur Palliativbetreuung gehört auch die Palliativberatung des Patienten und der Angehörigen über die letzte Lebensphase.
Übrigens: Der Gesetzgeber hat eine Möglichkeit geschaffen, die pflegenden Angehörigen von der Arbeit freizustellen damit sie genügend Zeit mit dem zu Pflegenden in seiner letzten Lebensphase verbringen können.
Wer bietet Palliativpflege an?
Die Palliativversorgung findet zum einen stationär in Palliativpflege-Stationen und zum anderen als ambulante Palliativpflege in der Palliativpflege in der häuslichen Umgebung statt. Wer im Krankenhaus austherapiert ist und keine Chance auf Heilung hat, kann sich entscheiden, über einen palliativen Pflegedienst zu Hause in den eigenen vier Wänden betreut zu werden oder in einem Sterbehospiz bzw. einer speziellen Palliativmedizin-Station in einem Krankenhaus.
Ist die Palliativpflege zu Hause machbar? Nicht immer sind die Gegebenheiten optimal, um dem Sterbenden zu Hause die bestmögliche Betreuung angedeihen zu lassen. Dann ist die Versorgung in einer Palliativpflegeeinrichtung die bessere Lösung. Klären Sie mit den behandelnden Ärzten und Pflegediensten ab, inwiefern eine ambulante Palliativversorgung zu Hause möglich ist.
Ich möchte Sie an dieser Stelle auf ein bundesweites Verzeichnis für Palliativstationen in Krankenhäusern, stationäre Hospize, SAPV-Teams, Palliativmedizinern sowie Palliativdienste im Krankenhaus aufmerksam machen. Das Verzeichnis ist unterglieder in Suchanfragen für erwachsene Patienten und Suchanfragen für Kinder und Jugendliche.
Sie suchen einen Pflegedienst in Ihrer Nähe? ► Kostenlose Pflegedienst-Suche
Was ist eine stationäre Pallitaivpflege?
Eine stationäre Palliativpflege/Hospizpflege findet in einem Hospiz oder einer Palliativabteilung eines Krankenhauses stat. Ausgebildete Fachkräfte betreuen den Patienten nicht nur medizinisch sondern ganzheitlich. Sie begleiten ihn in all seinen Phasen des Sterbens.
Was versteht man unter ganzheitlicher Betreuung?
Bei Palliativpflege-Patienten reicht eine normale medizinische Betreuung oder Pflege nicht mehr aus. Hier werden nicht nur körperliche Symptome behandelt, sondern alle physischen und psychischen Beschwerden. Der Mensch wird als Ganzes gesehen und ebenso behandelt.
Anzeige | Produktvorstellung
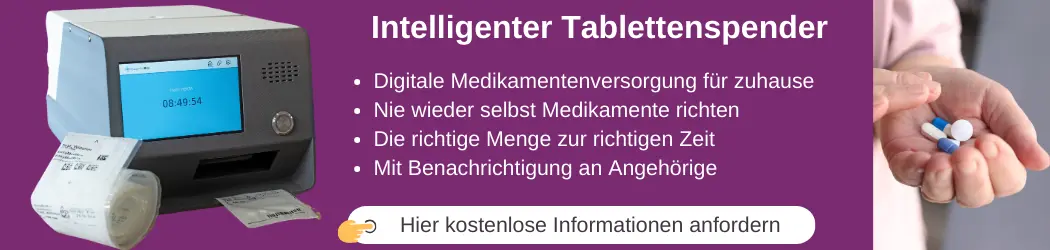
Individuell auf seine Bedürfnisse und seinen Gesundheitszustand zugeschnitten, kann durch die Mitarbeiter der Palliativpflege aber auch durch die Angehörigen des Patienten eine ganzheitliche Pflege folgendes beinhalten:
- Optimale pflegerische Versorgung
- Optimale Schmerzbehandlung, ohne Rücksichtnahme auf Spätfolgen
- Ehrliche Offenlegung bezüglich der Krankheit und deren absehbaren Endes ohne dem Patienten trotzdem seine Hoffnungen zu nehmen
- Bei Bedarf Versorgung mit (eiweißreicher und hochkalorischer) Spezialnahrung, falls dies vorm Patienten gewünscht wird
- Einsatz von erleichternden Therapien wie Massagen, Entspannungsübungen, Aromatherapie
- Verzicht auf nicht mehr nötige Medikamente
- Ablenkung durch Lesen/Vorlesen, Musik, Gespräche, oder Wiederaufnahme von Hobbys
- Schaffen von schönen Erinnerungen
- Unterstützung bei Angst, Hoffnungslosigkeit und depressiven Phasen des Patienten und der Angehörigen
- Hilfe bei der Akzeptanz des Todes
- Hilfe bei der Umsetzung letzter Wünsche
- Trauerbewältigung und Trauerbegleitung, Trost und Zuspruch
- Unterstützung durch Psychotherapeuten und Seelsorger
- Sterbebegleitung für Patient und Angehörige
- Sterben in Würde
- Die Wünsche des Patienten, die in einer Vorsorgevollmacht/Generalvollmacht hinterlegt sind, sollten eingehalten werden.
Warum sollte eine Palliativpflege in Anspruch genommen werden?
Egal ob die Palliativpflege in einem Pflegehospiz durchgeführt wird oder im häuslichen Umfeld durch einen Palliativpflegedienst, gibt es für die Angehörigen die Sicherheit, in den letzten Wochen und Monaten alles Menschenmögliche für den Sterbenden getan zu haben, um diesem das Sterben so weit wie möglich zu erleichtern.
Dieses Bewußtsein wird bei den Hinterbliebenen wahrscheinlich erst nach dem Tod des Patienten kommen, dann aber vielleicht umso stärker. Denn genau hier greift die Palliativpflege im Speziellen ein. Sie betreut den Patienten genauso wie die Angehörigen. Steht unterstützend mit Gesprächen bereit, erklärt die Krankheit und die weitere Vorgehensweise der Behandlung und läßt sich auf die Wünsche des Patienten und der Angehörigen ein. Alles zum Wohle des Sterbenden. Einen geliebten Menschen zu verlieren ist schon schwer genug, aber das Gefühl zu haben, in dieser Zeit nicht alles für ihn gegeben zu haben, wäre wahrscheinlich unerträglich.
Kostenübernahme für Palliativversorgung
Wird die Palliativpflege notwendig, übernehmen die Krankenkassen dafür die Kosten. Bei einer häuslichen Palliativpflege bedarf es einer Verordnung vom Arzt, die dann dem Palliativpflegedienst vorgelegt wird.
Die Kostenübernahme muss beantragt werden. Hier hilft mit Sicherheit aber der Sozialdienst des Krankenhauses, der Palliativstation (Hospiz) oder des Pflegedienstes.
Pflegegrade müssen richtig und schnell beantragt werden.
Extratipp: Wurde vor dem Ableben des Patienten ein Pflegegrad beantragt, aber vom MDK noch keine Begutachtung durchgeführt, kann nachträglich auf Aktenlage eine Einstufung (oder Höherstufung des vorhandenen Pflegegrades) der Pflegestufe erwirkt werden. Das heißt, dass mit dem Ableben des Patienten nicht automatisch das Recht auf die Einstufung eines Pflegegrades erlischt.
Weitere Anlaufstellen und Hilfen
- Die Sozialarbeiter von Palliativpflegeeinrichtungen und Palliativpflegediensten oder von Pflegestützpunkte können beratend zur Seite stehen was alles Finanzielle anbetrifft. Schließlich können unter Umständen die Angehörigen schnell in eine finanzielle Notlage geraten. Sie sind auch beim Stellen von Anträgen, Pflegestufen, usw. behilflich.
- Pflegestützpunkte beraten auch nach dem Tod, ob ein Anspruch auf Zuschüsse besteht.
- Auch Krankenkassen können in vielen Angelegenheiten unterstützend beraten.
- Sollte sich die häusliche Palliativpflege über einen längeren Zeitraum erstrecken, können auch Pflegekurse eine wertvolle Hilfe sein.
- Wer mit der Pflege überfordert ist oder wen der bevorstehende Tod des Angehörigen zu sehr belastet, sollte sich auch nicht scheuen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
- Auch an den Beistand von Pfarrern, Geistlichen oder Seelsorgern sollte gedacht werden, um Trost und Zuspruch für die schwierige Zeiten zu erhalten.
Weitere Beiträge zum Thema Pflege
- Pflegegrad 1 – Chance für finanzielle Unterstützung bei geringer Pflegebedürftigkeit
- Tipps, wie Sie Fehler bei der MDK-Begutachtung vermeiden
- Hilfe zur Pflege – Wann übernimmt das Sozialamt die Pflegekosten
Anzeige | Produktvorstellung

Kostenloser Newsletter.
Beste Insider-Tipps!
Tipps zu: Pflegegeld + Pflegeleistungen, Kosten + Zuschüssen
Kurzzeit- u. Verhinderungspflege, Fehler bei MDK-Begutachtung, Entlastungsbetrag, Gesetzesänderungen uvm.
Tragen Sie sich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter ein, damit Sie sich zukünftig im Pflegedschungel zurecht finden. Unser Newsletter erscheint 1-2 Mal pro Monat.
Quelle Bildmaterial: Fotolia #95647295 © fotoknips
- Über den Autor
- Neuste Beiträge
Helga Henzler war lange Jahre selbst pflegende Angehörige und hat ihre Eltern gepflegt. Durch die vielen Jahre an Erfahrung “aus erster Hand” verfügt sie über ein umfassendes Wissen im Bereich der Nächstenpflege. Als ausgebildete Autorin schreibt sie Fachbeiträge unter anderem für Pflege-durch-Angehörige.de und bereichert mit Ihrer umfassenden Erfahrung und Expertise unsere Themenwelt.

